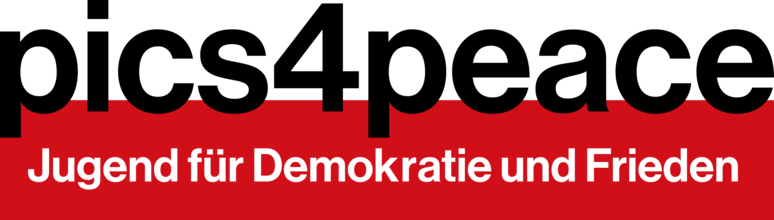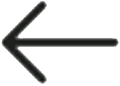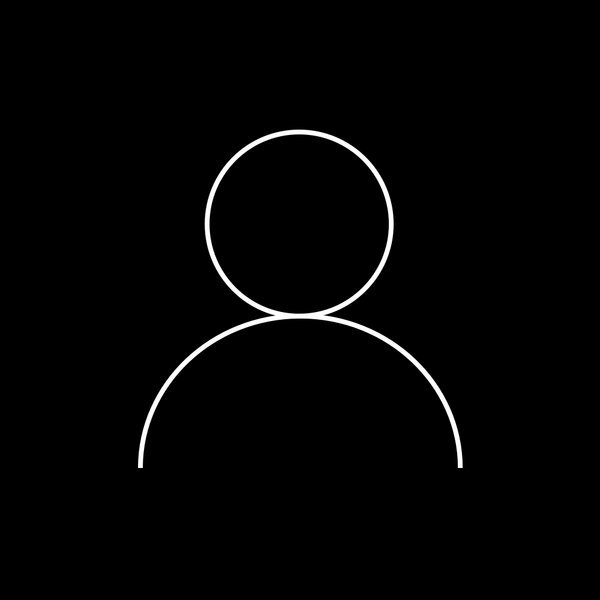Kaffeesahne und Angst
Info:
„Hörst du das?“, Frau Obermeier legt einen Finger an die Lippen und lauscht durch das bunte Treiben der Straße, „Das ist ein Buchfink!“ Mir fällt es schwer, in dem Lärm aus Passanten, klapperndem Geschirr und Nebentischgesprächen das zarte Stimmchen eines Vogels herauszuhören. Doch tatsächlich: Irgendetwas zwitschert angestrengt in schnellen Tonfolgen als müsste eine dringliche Geheimbotschaft übermittelt werden. Wahrscheinlich sitzt der Buchfink im nahen Forsythienstrauch, aber ich kann ihn nirgends entdecken. Dennoch freue ich mich über Frau Obermeiers Begeisterung. Ein Strahlen erhellt ihr von den Jahren durchfurchtes Gesicht, das sie wie immer sorgfältig geschminkt hat.
„Endlich ist Frühling!“, sage ich deshalb aus vollster Überzeugung. Mit der alten Dame im Café zu sitzen, gehört zu den schönen Seiten dieses Berufs. Selten habe ich privat die Möglichkeit, die ersten Sonnenstrahlen ausgiebig zu genießen, nur wenn ich eine Bewohnerin ins Freie begleite, spüre ich manchmal für einige Minuten einen Hauch von Entspannung durch meine Glieder wabern. Die dunkelhaarige Kellnerin bringt jetzt meinen Cappuccino und einen schwarzen Kaffee für Frau Obermeier. Ich sehe, wie diese verächtlich auf die Kaffeesahne blickt. Zum Glück ist die Kellnerin schon wieder weitergeeilt. Ich kenne die alte Dame gut genug, um zu wissen, was jetzt kommt: „Das soll Milch sein?“, stellt sie ihre rhetorische Frage, „Wir wären früher nie auf die Idee gekommen, dass man die in so kleinen Plastikdingern abfüllen kann. Wir hatten noch …“ „… richtige Eimer voll mit warmer, dampfender Milch“, ergänze ich lächelnd. Frau Obermeier nimmt es mir nicht übel: „Ich scheine mich zu wiederholen …“, sie schmunzelt. Ich nicke und zucke gleichzeitig die Achseln, was so viel heißen soll wie „Ist doch nicht schlimm“. „Wenn man so alt ist wie ich, sind Veränderungen schwierig, weißt du, Lydia!“ Sie rührt naserümpfend die Milch in ihren schwarzen Kaffee. Dabei spreizt sie ihren kleinen Finger ab, was sie noch edler wirken lässt als sie es ohnehin in ihrem rosa Kostüm bereits ist. „Das soll aber nicht heißen, dass früher alles besser war. Einiges war sogar viel schlechter. Euch geht es ja jetzt gut. Ich meine, ihr könnt Kaffeesahne in kleinen Plastikdingern kaufen und müsst euch keine Sorgen machen, wo die nächste Kuh steht. Das war nicht immer so. Kurz nach dem Krieg musste ich manchmal stundenlang laufen, um meinen Eltern eine volle Kanne mit nach Hause zu bringen.“ Frau Obermeier hält inne und ich sehe ihr an, dass sie für einen Augenblick wieder das kleine Mädchen ist, das keine Milch verschütten durfte. „Und den Juden, denen geht es auch viel besser“, fügt sie dann hinzu. Das ist neu. Gewöhnlich reden wir über das Wetter oder die Vergangenheit. Ich versuche das Thema Politik im Gespräch mit Patienten zu vermeiden. Wenn es sich gar nicht umgehen lässt, antworte ich mit Allgemeinplätzen. Manchmal macht ein alter Herr eine Bemerkung beim Lesen der Tageszeitung oder eine Dame seufzt, wenn die Nachrichten laufen. Freiwillig erzählen jedoch die wenigsten aus jener Zeit ihres Lebens, die wir im Geschichtsunterricht immer wieder durchgekaut haben. Um mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen, gebe ich nur ein zustimmendes „Mhm“ von mir.
„Das weißt du schon, oder? Dass die Juden damals verfolgt wurden?“, fragt Frau Obermeier direkt. Ich schaue sie überrascht an: „Ja, natürlich weiß ich das.“ „In unserer Straße wurden zwei Familien abgeholt. Die Familie Rosenthal hatte drei Mädchen, mit denen ich immer gespielt habe. Und dann waren sie eines Tages nicht mehr da.“ Frau Obermeier hält einen Moment inne und nimmt einen winzigen Schluck aus ihrer kleinen weißen Tasse. Ich überlege, ob ich etwas fragen soll. Dann entscheide ich mich, ihr lieber zuzuhören: „In der Schule wurde viel darüber gesprochen, wie anders die Juden sind. Welche Merkmale sie haben und woran wir sie erkennen. Unser Lehrer Herr Hohlbein redete immer davon, dass sie versuchen würden, uns zu verdrängen, dass sie uns etwas wegnehmen würden. Ich habe damals wirklich geglaubt, dass die Juden unendlich viele wären. Erst später habe ich gemerkt, dass ich gar keine Angst vor ihnen haben muss. Aber sie hätten so viele Gründe gehabt, Angst vor uns zu haben…“
Ich bin mir nicht sicher, wohin uns das Gespräch führen wird. Etwas unruhig rutsche ich auf meinem Sitzkissen hin und her und sehne mich zurück nach dem Thema Frühlingserwachen. Frau Obermeier sieht mich jetzt durchdringend an: „Lydia, ich hoffe, ihr lernt heute bessere Sachen in der Schule!“ „Naja, ich gehe nicht mehr zur Schule, aber ja … also wir haben über diese Zeit geredet.“ Die alte Dame scheint beruhigt: „Dann weißt du ja, dass das nicht noch einmal passieren darf. Meine Mutter – Gott hab sie selig – hat es nicht ertragen, was damals alles passiert ist. Sie hat sich das Leben genommen, als mein Vater in die NSDAP eingetreten ist. Ich war damals acht.“ Ich bekomme eine Gänsehaut und suche in Frau Obermeiers Gesicht nach einer Gefühlsregung, aber sie erzählt diese Geschichte, als wäre es nicht ihre eigene. „War ihre Mutter gegen Hitler?“, platze ich heraus. „Ja. Aber das wusste ich damals nicht. Mein Vater hat uns Kindern nur gesagt, dass sie fort ist. Er sprach immer von ihr, als wäre sie auf ein Schiff gestiegen und sehr weit weggefahren. Keiner sprach darüber, dass jemand „depressiv“ war. Das Wort gab es nicht. Erst viele Jahre später habe ich das Tagebuch meiner Mutter gefunden. Sie machte sich Sorgen, dass wir Kinder uns vor anderen Leuten verplappern. Ihnen erzählen, dass sie nicht an den Führer glaubt. Deshalb hat sie nie mit uns darüber gesprochen. Sie hat es gehasst, wie Vater diesen Leuten zujubelte. Sie hatte sogar Angst, dass er sie verrät. Es ging viel um Angst damals.“ Frau Obermeier stellt ihre Kaffeetasse zurück, die sie die ganze Zeit in ihren alten, schrumpeligen Händen gehalten hat. Ich warte darauf, dass sie weiterspricht, aber sie schweigt. „Ich werde jetzt mal zur Toilette gehen“, sagt sie dann plötzlich und erhebt sich für ihr Alter ungewöhnlich schnell. Wenn sie meine Hilfe bräuchte, würde sie darum bitten. Sie nimmt ihren Stock und entfernt sich mit wackeligen Schritten von unserem Tisch. Ihre Erzählung ist so plötzlich vorbei, wie sie angefangen hat. Ich hänge meinen Gedanken nach, überlege, ob ich die alte Dame bei ihrem Wiederkommen noch etwas fragen soll. In diesem Moment werde ich auf ein Gespräch aufmerksam, das hinter mir stattfindet: Ich drehe mich kurz um und sehe, dass ein Mann im mittleren Alter auf seine Frau einredet. Er wirkt mit seinem Wohlstandsbauch unter dem weißen Hemd nicht wie jemand, der sich Sorgen über das Leben machen muss. Aber seine Lautstärke und seine wilde Gestik verraten mir, dass ihn etwas stark aufregt: „Die können doch nicht alles bekommen! Die sollen mal dahin zurückgehen, wo sie herkommen! Unsereins bekommt auch keine drei Zimmer-Wohnung geschenkt.“ „Die bekommen sie geschenkt?“, höre ich seine Frau schüchtern fragen. Mit der altmodischen Brille und der Dauerwelle wirkte sie beim Umdrehen auf mich, als wäre sie einem 80er Jahre-Film entsprungen. „Klar! Weil wir es ja haben. Dabei wollen die uns missionieren! Wenn du nicht an deren Gott glaubst, dann sprengen sie dich in die Luft. Und vorher machen sie erstmal ganz viele Kinder, die dann in unsere Sozialsysteme einfallen.“ Langsam bekomme ich schlechte Laune, die Stimme des Mannes hat einen aggressiven Unterton und seine Lautstärke macht es für alle um ihn herum unmöglich, wegzuhören. Er drängt der Umgebung seine Meinung auf, als würde er Blut in einen Swimmingpool mit türkis-schimmerndem Wasser gießen. „Dagegen muss endlich mal jemand was tun!“, erklärt er jetzt entschlossen. „Und was könnte man da machen?“, fragt die Frau ganz in der Rolle seiner praktischen Beraterin. „Na, ausweisen! Alle! Oder wegsperren. Die, die was gemacht haben. Damit das den anderen eine Warnung ist.“ Ohne mich noch einmal umzusehen, kann ich mir vorstellen, wie rot das Gesicht des Mannes vor Anstrengung geworden sein muss. Er spuckt die Worte förmlich heraus. „Aber da kommen jetzt immer mehr, oder?“, fragt die Frau mit der Dauerwelle vorsichtig. „Na, wenn wir die einladen! Natürlich! Die kommen solange, bis sie uns Deutsche vernichtet haben! Deshalb will ich nicht, dass du abends alleine raus gehst. Das ist ja gefährlich heute!“ Ich habe letzte Woche gelesen, dass die Zahlen der Kriminaldelikte seit Jahren rückläufig sind. Aber jetzt bin ich mir selbst nicht mehr ganz sicher. Der Mann wirkt so überzeugt. Wieso sollte er sich sonst so aufregen, wenn es keine wirkliche Gefahr gäbe? Statt die Frühlingssonne zu genießen, fühle ich mich plötzlich bedroht. Etwas scheint schief zu laufen und ich sehe es nicht. Die alarmierende Grundhaltung des Mannes macht mich nervös, ohne wirklich einordnen zu können, was los ist. Ein jahrhundertealter Reflex signalisiert meinem ganzen System, dass Panik angebracht ist. Weglaufen wäre eine Lösung, aber ich bin hier auf diesem Kaffeestuhl gefangen, weil ich auf Frau Obermeier warten muss. „Jedenfalls müssen wir dafür sorgen, dass die wegbleiben. Wenn sie nicht verstehen, dass das unser Land ist und sie hier nicht willkommen sind, ertrinken sie eben. Das geht nicht länger so weiter. Alle, die keine von uns sind, müssen raus!“ Jetzt brüllt er fast. „Aber ist da nicht Krieg, wo die herkommen?“, fragt seine Frau ganz leise. Ich bekomme eine Ahnung davon, dass ihre Fragen vielleicht mehr sind als bloße Bestätigung ihres Gegenübers. „Bist du für die, oder was? Willst du jetzt zum Islam übertreten?!“, er lacht verächtlich, „Dann musste aber immer zuhause bleiben und für mich kochen.“ Einen Moment lang ist es still. Ich sehe, Frau Obermeier langsam aus dem Café zurückkommen. Ich habe vergessen, was ich sie noch fragen wollte. Irgendetwas über die Juden oder die Verfolgung oder die Angst. „Aber ich koche doch jetzt auch schon für dich“, höre ich die Frau noch zu ihrem Mann sagen. Dann kann ich endlich wieder über Vogelgezwitscher reden.

Über den/die Künstler/in