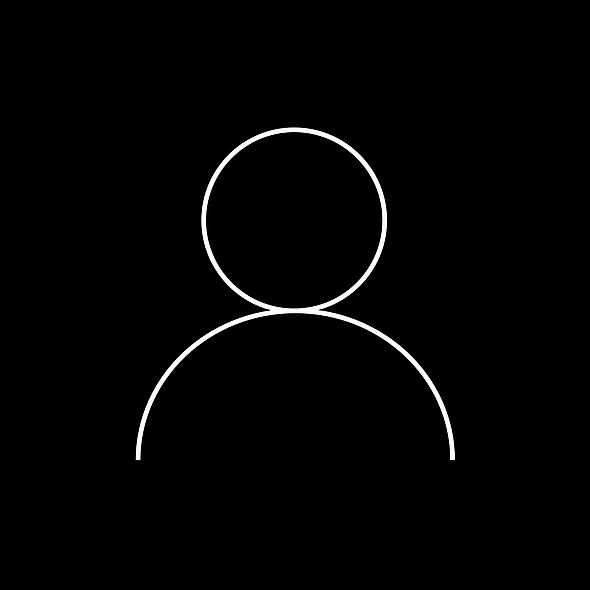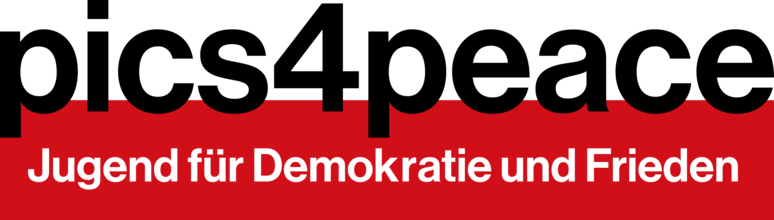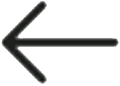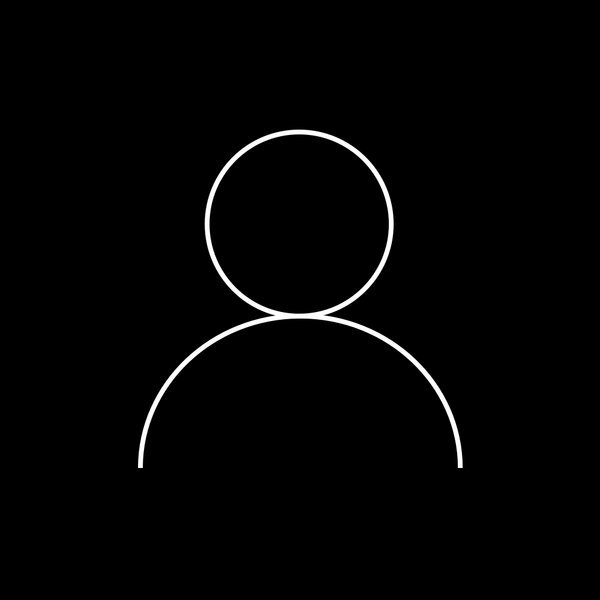Als ich mich endlich mal richtig europäisch fühlte
Info:
Weder das Erasmus-Semester noch die Wissenschaft konnten unsere Autorin Julia Hackober von der Idee einer kollektiven europäischen Identität überzeugen. Doch dann reiste sie zu einer Hochzeit in die Slowakei.
Hinter Prag fällt die Klimaanlage aus. Die Luft im Eurocity-Waggon wird minütlich stickiger, als eine Schulklasse im Teenageralter zusteigt, bin ich der Ohnmacht nahe. Kurzfristig halte ich es für eine ausgesprochen bescheuerte Idee, zehn Stunden lang mit dem Zug von Berlin in die Südslowakei zu gondeln, um als Brautjungfer im peachfarbenen Kleid einer Freundin bei ihrer Hochzeit beizustehen.
Irgendwann erreiche ich dann aber halb aufgelöst Veľké Úľany. Dort, eine Stunde von Bratislava entfernt, heiratet meine Freundin, die der ungarischen Bevölkerungsminderheit in der Slowakei angehört, einen Aussiedler aus Polen, genauer gesagt, aus Schlesien. Eigentlich leben die beiden in München, die Hochzeitsfeier findet aber im Heimatort meiner Freundin statt, in dem Pub, wo sich das Paar bei einem Jugendaustausch kennengelernt hat.
Da hat sich also ergeben, was die Europäische Kommission seit Jahren mit dem mythosumwobenen Erasmus-Programms künstlich zu erzeugen versucht: dass junge Leute sich vorstellen können, jemanden zu lieben, der nicht wie sie selbst in Stuppach oder Templin geboren und aufgewachsen und im gleichen Jahr beim Abi-Streich komatös betrunken gewesen ist.
Die Hochzeitsfeier in Veľké Úľany fällt aus interkultureller Perspektive, auch mal abgesehen vom Brautpaar an sich, äußerst anspruchsvoll aus: Der Traugottesdienst wird auf Deutsch und Ungarisch gehalten. Schorsch und Martina aus Bayern kommen in Tracht und verabschieden den Großvater der Braut mit einem munteren „Pfiat Di“. Einige Osteuropastudenten nehmen sorgfältig die Äußerungen der Gäste über die Slowakei auseinander (der Ausspruch „Bratislava wirkt ja gar nicht so osteuropäisch“ erntet nur ein genervtes Augenrollen ob des Mangels an interkultureller Kompetenz), setzen ihre hehren Ansprüche an ein geeintes Europa nach ein paar Flaschen Wein dann aber auch auf der Tanzfläche in die Tat um. Und plötzlich tanzen alle zusammen Polonaise und Csárdás durch den leeren Pool. Unity in Diversity eben, das wusste ja schon Robert Schumann, dass darin das Geheimnis Europas liegt.
Bei dieser Hochzeitsfeier denke ich mir, dass mein Studium der Europäischen Kultur wohl doch nicht völlig umsonst war. Den Eindruck hatte ich in den letzten Jahren nämlich manches Mal. Alles, was ich über die enorme Bedeutung einer kollektiven europäischen Identität für Europa als „Superpower“ etc. gelernt hatte, schien mir gnadenlos weit hergeholt, nicht nur in Anbetracht der Wirtschaftskrise.
Arrogante Franzosen machten mir im Auslandssemester das Leben schwer, weil sie Deutsche durchweg für spießig hielten; noch mehr nerven mich allerdings deutsche Medizinstudentinnen, die sich ultraexotisch vorkommen, wenn sie mal ein Semester in Innsbruck verbringen. Mir schien plötzlich an sämtlichen Uralt-Nationalklischees ziemlich viel Wahres dran zu sein.
Das Hochzeitswochenende kam da gerade recht. Weil es nämlich zeigte, dass die EU-Austrittsdiskussionen die europäische Idee noch nicht vollkommen zerstört haben und dass weder der Eurozentrismus noch die Wirtschaftspower die gemeinsame europäische Identität bestimmen, sondern tatsächlich das kollektive Gedächtnis.
Und da kann man eben ganz lebenspraktisch wie ideell proeuropäisch argumentieren: In Veľké Úľany freute man sich unisono darüber, dass es, bei allem Anreise-Hassle (die Benzinpreise in Österreich!), fast 30 Jahre nach dem Mauerfall genauso einfach ist, in die Slowakei zu reisen, wie die Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern zu passieren.
Der harte Kern der Hochzeitsgesellschaft, bestehend aus Ungarn, Slowaken, Schlesiern, Schweizern, Bayern und einer Preußin, lag sich jedenfalls noch um sieben Uhr morgens schwankend in den Armen.
Diesen Text habe ich im Juni 2015 geschrieben und auf welt.de veröffentlicht. Aus heutiger Perspektive empfinde ich ihn als geradezu unheimlich: Wie selbstverständlich nahmen wir noch vor drei Jahren die Europäische Union und all ihre Annehmlichkeiten! Nur ein Jahr später stimmte Großbritannien für den EU-Austritt. Natürlich ist vieles, was sich die Organe der EU ausdenken und produzieren, ein bisschen verrückt (Gurkenkrümmung! DSGVO!), aber sie hat doch dafür gesorgt, dass unser Leben so frei und weltoffen ist, wie wir es kennen. Ich hoffe, dass noch viele Generationen im sorglosen Erasmus-Spirit erwachsen werden können.
Über den/die Künstler/in